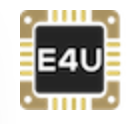Da das rotierende magnetische Flussdurch jedes der Rotorleiterstücke schneidet, fließt ein induzierter Umlaufstrom durch die Leiterstücke. Beim Anfahren steht der Rotor still und das Statorfeld dreht sich mit der Synchrongeschwindigkeit, die relative Bewegung zwischen dem rotierenden Feld und dem Rotor ist maximal. Daher ist die Rate der Schnitte des Flusses mit den Rotorleitern maximal, der induzierte Strom ist unter diesen Bedingungen maximal. Da jedoch die Ursache für den induzierten Strom diese relative Geschwindigkeit ist, versucht der Rotor, diese relative Geschwindigkeit zu reduzieren und beginnt daher, in Richtung des rotierenden magnetischen Feldes zu drehen, um die Synchrongeschwindigkeit zu erreichen. Sobald der Rotor die Synchrongeschwindigkeit erreicht, wird die relative Geschwindigkeit zwischen Rotor und rotierendem magnetischem Feld null, es gibt also keinen weiteren Flussschnitt und folglich keinen induzierten Strom in den Rotorleitern. Da der induzierte Strom Null wird, gibt es keinen weiteren Bedarf, die relative Geschwindigkeit zwischen Rotor und rotierendem magnetischem Feld auf Null zu halten, daher fällt die Rotorgeschwindigkeit.
Da das rotierende magnetische Flussdurch jedes der Rotorleiterstücke schneidet, fließt ein induzierter Umlaufstrom durch die Leiterstücke. Beim Anfahren steht der Rotor still und das Statorfeld dreht sich mit der Synchrongeschwindigkeit, die relative Bewegung zwischen dem rotierenden Feld und dem Rotor ist maximal. Daher ist die Rate der Schnitte des Flusses mit den Rotorleitern maximal, der induzierte Strom ist unter diesen Bedingungen maximal. Da jedoch die Ursache für den induzierten Strom diese relative Geschwindigkeit ist, versucht der Rotor, diese relative Geschwindigkeit zu reduzieren und beginnt daher, in Richtung des rotierenden magnetischen Feldes zu drehen, um die Synchrongeschwindigkeit zu erreichen. Sobald der Rotor die Synchrongeschwindigkeit erreicht, wird die relative Geschwindigkeit zwischen Rotor und rotierendem magnetischem Feld null, es gibt also keinen weiteren Flussschnitt und folglich keinen induzierten Strom in den Rotorleitern. Da der induzierte Strom Null wird, gibt es keinen weiteren Bedarf, die relative Geschwindigkeit zwischen Rotor und rotierendem magnetischem Feld auf Null zu halten, daher fällt die Rotorgeschwindigkeit.
Sobald die Rotorgeschwindigkeit fällt, erhält die relative Geschwindigkeit zwischen Rotor und rotierendem magnetischem Feld wieder einen nicht-null Wert, was erneut zu einem induzierten Strom in den Rotorleitern führt, dann versucht der Rotor erneut, die Synchrongeschwindigkeit zu erreichen, und dies setzt sich fort, bis der Motor eingeschaltet ist. Aufgrund dieses Phänomens wird der Rotor weder die Synchrongeschwindigkeit erreichen noch während des normalen Betriebs stehen bleiben. Der Unterschied zwischen der Synchrongeschwindigkeit und der Rotorgeschwindigkeit in Bezug auf die Synchrongeschwindigkeit wird als Schlupf des Asynchronmotors bezeichnet.
Der Schlupf bei einem normal laufenden Asynchronmotor variiert typischerweise von 1 % bis 3 %, je nach Belastungszustand des Motors. Nun werden wir versuchen, die Geschwindigkeits-Strom-Kennlinien des Asynchronmotors zu zeichnen – lassen Sie uns ein Beispiel eines großen Kesselgebläses nehmen.

In der Kennlinie wird die Y-Achse in Sekunden und die X-Achse in Prozent des Statorstroms genommen. Wenn der Rotor stillsteht, also im Anlaufzustand, ist der Schlupf maximal, daher ist der induzierte Strom im Rotor maximal und aufgrund der Transformatorwirkung zieht der Stator einen starken Strom aus der Versorgung, und dieser beträgt etwa 600 % des Nennvollaststroms. Während der Beschleunigung des Rotors verringert sich der Schlupf, daher fällt der Rotorstrom und damit auch der Statorstrom auf etwa 500 % des Nennvollaststroms innerhalb von 12 Sekunden, wenn die Rotorgeschwindigkeit 80 % der Synchrongeschwindigkeit erreicht. Danach fällt der Statorstrom schnell auf den Nennwert, wenn der Rotor seine normale Geschwindigkeit erreicht.
Nun werden wir über den thermischen Überlastschutz des Elektromotors oder das Überhitzungsproblem des Elektromotors und die Notwendigkeit des Motorthermalschutzes sprechen.
Wenn wir an das Überhitzen eines Motors denken, fällt uns zuerst die Überlastung ein. Wegen mechanischer Überlastung zieht der Motor einen höheren Strom aus der Versorgung, was zu übermäßigem Überhitzen des Motors führt. Der Motor kann auch übermäßig überhitzen, wenn der Rotor mechanisch blockiert wird, d.h. durch eine externe mechanische Kraft stationär wird. In dieser Situation zieht der Motor einen extrem hohen Strom aus der Versorgung, was ebenfalls zu thermischer Überlastung des Motors oder zu einem extremen Überhitzungsproblem führt. Ein weiterer Grund für Überhitzung ist eine niedrige Versorgungsspannung. Da die vom Motor gezogene Leistung von der Belastung abhängt, zieht der Motor bei niedriger Versorgungsspannung einen höheren Strom aus dem Netz, um den erforderlichen Drehmomentbedarf zu gewährleisten. Eine Einphasigkeit verursacht ebenfalls thermische Überlastung des Motors. Wenn eine Phase der Versorgung außer Betrieb ist, ziehen die verbleibenden zwei Phasen einen höheren Strom, um den erforderlichen Lastdrehmomentbedarf zu gewährleisten, und dies führt zum Überhitzen des Motors. Ein Ungleichgewicht zwischen den drei Phasen der Versorgung verursacht ebenfalls Überhitzung der Motorenwicklung, da ein ungleichgewichtiges System zu negativen Sequenzströmen in der Statorwicklung führt. Auch plötzliche Verluste und Wiederherstellung der Versorgungsspannung können zu extremer Erwärmung des Motors führen. Da durch den plötzlichen Verlust der Versorgungsspannung der Motor abgebremst wird und durch die plötzliche Wiederherstellung der Spannung der Motor beschleunigt wird, um seine Nengeschwindigkeit zu erreichen, zieht der Motor dafür einen höheren Strom aus der Versorgung.
Da thermische Überlastung oder Überhitzung des Motors zu Isolierschäden und Schäden an der Wicklung führen kann, sollte der Motor für einen ordnungsgemäßen Motorthermalschutz gegen die folgenden Bedingungen geschützt sein:
Mechanische Überlastung,
Blockierung des Motorwellenlagers,
Niedrige Versorgungsspannung,
Einphasigkeit der Versorgungsleitung,
Ungleiche Versorgungsleitung,
Plötzlicher Verlust und Wiederherstellung der Versorgungsspannung.
Das grundlegendste Schutzsystem des Motors ist der thermische Überlastschutz, der primär den Schutz vor all den oben genannten Bedingungen abdeckt. Um das grundlegende Prinzip des thermischen Überlastschutzes zu verstehen, untersuchen wir das Schaltbild eines grundlegenden Motorschaltkreises.

Im obigen Bild, wenn der START-Taster geschlossen wird, wird die Startspule über den Transformator gespeist. Sobald die Startspule gespeist wird, schließen sich die normal offen (NO) Kontakte 5, daher erhält der Motor die Versorgungsspannung an seinen Anschlüssen und beginnt, sich zu drehen. Diese Startspule schließt auch den Kontakt 4, was die Startspule gespeist hält, auch wenn der START-Tasterkontakt aus seiner geschlossenen Position freigegeben wird. Um den Motor zu stoppen, gibt es mehrere normal geschlossene (NC) Kontakte in Serie mit der Startspule, wie in der Abbildung gezeigt. Einer davon ist der STOP-Tasterkontakt. Wenn der STOP-Taster gedrückt wird, öffnet sich dieser Tasterkontakt und unterbricht die Kontinuität des Startspulenkreises, wodurch die Startspule de-energisiert wird. Daher gehen die Kontakte 5 und 4 in ihre normal offene Position zurück. Dann, ohne Spannung an den Motorterminals, wird der Motor letztendlich stehen. Gleiches gilt, wenn einer der anderen NC-Kontakte (1, 2 und 3), die in Serie mit der Startspule verbunden sind, offen ist; dies stoppt den Motor ebenfalls. Diese NC-Kontakte sind elektrisch mit verschiedenen Schutzrelais gekoppelt, um den Betrieb des Motors bei verschiedenen unnormalen Bedingungen zu stoppen.
Betrachten wir nun das thermische Überlastrelais und seine Funktion im Motorthermalschutz.
Die Sekundärseite der Transformatoren, die in Reihe mit dem Motorkreis liegen, sind mit einem bimetallischen Streifen des thermischen Überlastrelais (49) verbunden. Wie in der unten stehenden Abbildung gezeigt, wenn der Strom durch die Sekundärseite eines der Transformatoren seinen vorgegebenen Wert für eine bestimmte Zeit überschreitet, wird der bimetallische Streifen überhitzt und verformt, was letztendlich zur Betätigung des Relais 49 führt. Sobald das Relais 49 betätigt wird, werden die NC-Kontakte 1 und 2 geöffnet, was die Startspule de-energisiert und den Motor stoppt.

Eine weitere Sache, die wir beim Bereitstellen des Motorthermalschutzes beachten müssen. Jeder Motor hat tatsächlich einen vorbestimmten Überlasttoleranzwert. Das bedeutet, jeder Motor kann über seine Nennleistung hinaus für einen bestimmten zulässigen Zeitraum laufen, abhängig von seiner Belastung. Wie lange ein Motor sicher für eine bestimmte Belastung laufen kann, wird vom Hersteller spezifiziert. Die Beziehung zwischen verschiedenen Belastungen am Motor und den entsprechenden zulässigen Zeiträumen, in denen der Motor unter diesen Bedingungen sicher laufen kann, wird als thermische Grenzkurve des Motors bezeichnet. Sehen wir uns die Kurve eines bestimmten Motors an, wie unten gezeigt.

Hier repräsentiert die Y-Achse oder vertikale Achse die zulässige Zeit in Sekunden und die X-Achse oder horizontale Achse den Prozentsatz der Überlast. Hier ist aus der Kurve klar, dass der Motor ohne Schaden durch Überhitzung für einen langen Zeitraum bei 100 % der Nennleistung sicher laufen kann. Er kann 1000 Sekunden bei 200 % der normalen Nennleistung sicher laufen. Er kann 100 Sekunden bei 300 % der normalen Nennleistung sicher laufen. Er kann 15 Sekunden bei 600 % der normalen Nennleistung sicher laufen. Der obere Teil der Kurve stellt den normalen Betriebszustand des Rotors dar, und der unterste Teil stellt den mechanisch blockierten Zustand des Rotors dar.
Nun sollte die Betriebszeit-Versus-Aktivierungsstromkurve des ausgewählten thermischen Überlastrelais unter der thermischen Grenzkurve des Motors für eine zufriedenstellende und sichere Betriebsweise liegen. Lassen Sie uns weitere Details besprechen.

Denken Sie an die Eigenschaften des Anlaufstroms des Motors – Während des Anlaufs des Asynchronmotors geht der Statorstrom über 600 % des normalen Nennstroms hinaus, bleibt aber nur 10 bis 12 Sekunden, danach fällt der Statorstrom plötzlich auf den normalen Nennwert. Wenn das thermische Überlastrelais vor diesen 10 bis 12 Sekunden für den Strom von 600 % des normalen Nennwerts betätigt wird, kann der Motor nicht gestartet werden. Daher kann geschlossen werden, dass die Betriebszeit-Versus-Aktivierungsstromkurve des ausgewählten thermischen Überlastrelais unter der thermischen Grenzkurve des Motors, aber oberhalb der Anlaufstromcharakteristik des Motors liegen sollte. Die wahrscheinliche Position der thermischen Stromrelaisharmonik ist durch diese beiden genannten Kurven begrenzt, wie in der Grafik durch den hervorgehobenen Bereich gezeigt.
Eine weitere Sache, die bei der Auswahl des thermischen Überlastrelais berücksichtigt werden muss, ist, dass dieses Relais kein instantisches Relais ist. Es hat eine minimale Verzögerung in der Betätigung, da der bimetallische Streifen eine Mindestzeit benötigt, um sich aufzuheizen und für den Maximalwert des Betätigungsstroms zu verformen. Aus der Grafik geht hervor, dass das thermische Relais nach 25 bis 30 Sekunden betätigt wird, wenn der Rotor plötzlich mechanisch blockiert wird oder der Motor nicht starten kann. In dieser Situation zieht der Motor einen enormen Strom aus der Versorgung. Wenn der Motor nicht schneller isoliert wird, können schwerwiegende Schäden auftreten.

Dieses Problem wird durch die Bereitstellung eines Zeitüberstromrelais mit hoher Ansprechschwelle gelöst. Die Zeitstromcharakteristik dieser Überstromrelais wird so gewählt, dass für geringere Überlastwerte das Relais nicht betätigt wird, da das thermische Überlastrelais vorher betätigt wird. Aber für höhere Überlastwerte und für den blockierten Rotorzustand wird das Zeitüberlastrelais anstelle des thermischen Relais betätigt, da das erstere viel früher als das letztere betätigt wird.
Daher werden sowohl das bimetallische Überlastrelais als auch das Zeitüberstromrelais für einen vollständigen Motorthermalschutz bereitgestellt.
Es gibt einen Hauptnachteil des bimetallischen thermischen Überlastrelais, da die Heiz- und Kühlrate des Bimetalls durch die Umgebungstemperatur beeinflusst wird, kann sich die Leistung des Relais bei verschiedenen Umgebungstemperaturen unterscheiden. Dieses Problem kann durch die Verwendung eines RTD oder Widerstandstemperaturdetektors gelöst werden. Größere und anspruchsvollere Motoren werden durch die Verwendung von RTDs präziser gegen thermische Überlastung geschützt. In den Statorschlitzen werden RTDs zusammen mit der Statorwicklung platziert. Der Widerstand des RTD ändert sich mit der Temperaturänderung, und dieser veränderte Widerstands-Wert wird durch einen Wheatstone-Brückenschaltkreis erfasst.
Dieses Schema des Motorthermalschutzes ist sehr einfach. Der RTD des Stators wird als ein Arm der ausgeglichenen Wheatstone-Brücke verwendet. Der Stromdurchfluss durch das Relais 49 hängt vom Grad der Unausgeglichenheit der Brücke ab. Je höher die Temperatur der Statorwicklung, desto höher der elektrische Widerstand des Detektors, was die ausgeglichene Bedingung der Brücke stört. Als Ergebnis fließt Strom durch das Relais 49 und das Relais wird nach einem vorbestimmten Wert dieses ungleichgewichtigen Stroms betätigt und letztendlich öffnet der Starterkontakt, um die Versorgung des Motors zu stoppen.

Erklärung: Respektiere das Original, gute Artikel sind es wert, geteilt zu werden. Bei Verletzung des Urheberrechts bitte um Löschung kontaktieren.